
|
Maximale Flexibilität in der Fertigung durch Software Defined ManufacturingEin Interview mit Prof. Dr.-Ing. Oliver Riedel Software spielt nicht nur in den Produkten eine immer wichtigere Rolle, sondern ist zunehmend auch für die Steuerung von Fertigungsprozessen bedeutend. Welche Vorteile Software Defined Manufacturing (SDM) gegenüber klassischen Steuerungsarchitekturen bietet und welche Herausforderungen bei der Implementierung von SDM zu bewältigen sind, erläutert Prof. Dr.-Ing. Oliver Riedel von der Universität Stuttgart im Interview. 
Frage: Herr Prof. Riedel, was versteht man unter Software Defined Manufacturing? Riedel: Software Defined Manufacturing heißt vom Grundgedanken, dass ich eine sehr universelle Möglichkeit habe, Fertigungsprozesse zu gestalten. Statt diese Prozesse statisch in einer Steuerung, wie beispielsweise einer SPS zu programmieren, erreiche ich mehr Wandlungsfähigkeit dadurch, dass das Produkt weiß, wie es produziert werden soll und die zugehörige Software generiert werden kann. Ein zweiter Aspekt ist, dass sich die Produktion immer weiter in Richtung Digitalisierung bewegt, und Digitalisierung bedeutet mehr Software und Vernetzung. Getrieben wird das Ganze von den Business-Prozessen, die da sagen, wir brauchen kleinere Losgrößen, kürzere Fertigungszeiten und geringere Kosten. Das kriegt man nur dadurch hin, dass man die Hardware-Abhängigkeit von Produktionsmitteln langsam auflöst und die Entscheidung, wie gefertigt wird, in die Software verlagert. Dazu wird in künftigen Steuerungsarchitekturen die Software von der Hardware abstrahiert. Frage: Inwiefern geht SDM über die Ansätze von Industrie 4.0 hinaus? Riedel: Industrie 4.0 ist in vielerlei Hinsicht ein technischer Enabler. Vom Grundprinzip ist es das Paradigma der Vernetzung von allem. Früher hatte man horizontal eine sehr gute Kommunikation, aber vertikal ging das nur über Gateways. Überspitzt gesagt hat ein ERP-System niemals mit einem Sensor in Produktion kommuniziert. Ob das sinnvoll ist, ist ein anderes Paar Schuhe, aber heute ist das technisch möglich. Mit der Verknüpfung über die Ebenen hinweg kamen neue Protokolle wie OPC-UA, die Verwaltungsschale etc.. Von daher hat Industrie 4.0 die Kommunikation und Vernetzung sehr stark befähigt, während SDM massiv in die Prozessgestaltung geht. Aber ohne Industrie 4.0 gäbe es kein SDM. 
Frage: Was sind die wesentlichen Grundprinzipien von SDM? Riedel: Ein wesentliches Grundprinzip ist, dass ich über die Generalisierung von Fertigungsprozessen nachdenke. Stellen wir uns mal einen komplexeren Prozess wie die Türenfertigung für Autos vor. Warum brauchen Automobilhersteller pro Fahrzeug eine andere Türfertigungsanlage statt einer General-Purpose-Anlage, die von der Tür die geometrischen Abmaße und die Position der Spannpratzen für das Schweißen mitgeteilt bekommt? Auf dieser Anlage könnte ich jede Türe fertigen, ohne Änderungen im Vorrichtungsbau, wenn ich mich an eine bestimmte Produktklasse halte. Eine Kühlschranktür zu fertigen, wird nicht funktionieren, aber ich flexibilisiere ganz massiv meine Fertigung dadurch, dass Parametrik, Abläufe, Regler, usw. nicht mehr fest einprogrammiert ist, sondern Eigenschaften hat, die aus der Varianz des Produktes kommen. Frage: Kann man SDM ohne einen vollständigen digitalen Zwilling der Fertigungsanlagen realisieren? Riedel: Ja und Punkt. Der digitale Zwilling ist für mich ein Reizwort. Was ist der digitale Zwilling? Er ist eine Möglichkeit, Prozesse und Ressourcen in digitaler Form abzubilden, mit einer Genauigkeit, dass er sich der Realität annähert. Wie genau der digitale Zwilling ist, hängt von der Art der Prozesse ab. Für klassische Abläufe kein Problem, aber haben Sie schon mal einen digitalen Zwilling gesehen, der in seinem Modell die Temperaturdrift berücksichtigt? Ich nicht. 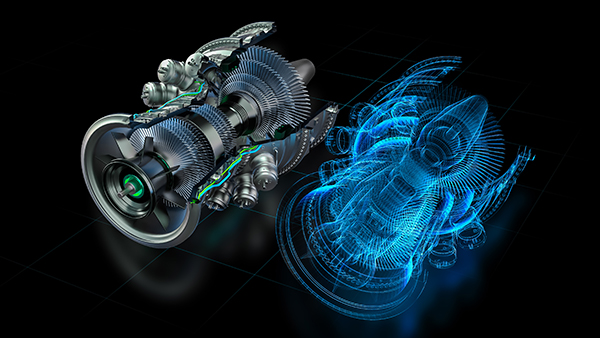
Frage: Was heißt Temperaturdrift? Riedel: Ganz einfach, mein Prozess funktioniert bei 20 Grad so bei 25 Grad so und bei 35 Grad nochmal anders. Es gibt in der Produktion viele Parameter, die für die virtuelle Inbetriebnahme, um ein anderes Buzz Word zu nehmen, heute schon sehr gut nutzbar sind. Aber wenn der digitale Zwilling zu 100 Prozent funktionieren würde, dann bräuchte man den letzten Rest der realen Inbetriebnahme nicht mehr zu machen. Frage: Die Tatsache, dass der digitale Zwilling nie hundertprozentig genau ist, schränkt die Möglichkeiten des SDM nicht ein? Riedel: Nein, aber man braucht ihn auch nicht zwingend. Wir haben die absolut genauen Modelle nicht, aber wir haben Beobachtungen aus der Vergangenheit und können ein hinreichend genaues Modell mit den historischen Daten anreichern. Das nennt man Grey Box und das ist das, wo die SDM hinzielt und wo auch die Reise in der Simulationstechnik hingeht. Frage: Bedeutet SDM das Aus der speicherprogrammierbaren Steuerungen? Riedel: So radikal würde ich das nicht formulieren, aber die SPS wird auf die elementaren Prozesse reduziert. Heute zeichnet sie sich noch durch eine spezielle Hardware aus, die sich aber langsam in Richtung Microcontroller bewegt und dabei ist, ganz in der Software zu verschwinden. Der nächste Schritt ist, die SPS komplett zu virtualisieren und mehrere Steuerungen auf einem Server laufen zu lassen. SDM kann diese Technik nutzen, um die Fertigungsabläufe vollständig zu flexibilisieren, indem sie festlegt, welche Steuerung unter welcher Prozessbedingung gilt. Man kann sogar unterschiedliche Versionsstände im laufenden Betrieb auswechseln. Das funktioniert inzwischen selbst für zeitkritische Dinge im Millisekunden-Bereich. 
Frage: Welche Herausforderungen sind bei der Implementierung von SDM zu bewältigen? Riedel: Das sind mehrere. Eine ist die lange Abschreibungsdauer von Produktions-Equipment. In den Firmen stecken sehr viele Investitionen, die mit der alten Technik laufen. Eine weitere ist das Skill-Set. Deshalb sehen wir es an der Uni und in der Forschung als unsere Aufgabe an, beim klassischen Maschinenbauer Verständnis für die digitalen Prozesse zu wecken und den IT-Nerds beizubringen, dass ihre Lösungen auch in der Produktion funktionieren müssen. Ausbildung und Awareness auf allen Ebenen des Unternehmens zu erreichen, ist nicht einfach. Man braucht Entscheidungsträger, die verstehen, dass Informationsmanagement ein Produktionsfaktor ist. Frage: Ist SDM überhaupt mit dem Brownfield-Ansatz in der Produktion kompatibel? Riedel: Man kann ähnlich wie bei Industrie 4.0 vorgehen und das Brownfield in ein Schalenmodell verpacken. Eine Werkzeugmaschine, die keinen Netzanschluss hat, bekommt eine Schale und auf der Feldbus-Kommunikationsebene ein Gateway, das heißt sie ist nicht nativ angeschlossen, sondern über ein Interface. Damit kann ich nicht die komplette Funktion der Maschine steuern, aber ich bekomme zumindest Daten aus dem System. So kann man auch beim SDM hingehen, und das Brownfield kapseln. Aber klar, das Brownfield schränkt die Möglichkeiten ein. Die vorher beschriebene Lösung mit den Spannpratzen funktioniert nicht, wenn sie festgeschraubt sind und keine Antriebe haben. Ich muss also investieren. Frage: Ergeben sich durch SDM zusätzliche Anforderungen in punkto Cyber-Sicherheit? Riedel: Nicht über die Maße hinaus, die wir uns schon mit Industrie 4.0 einhandeln. Allerdings ist das Gefahrenpotenzial, wenn jemand eindringt, umso größer, je mehr ich in Richtung Software gehe. Wenn ich bei Industrie 4.0 definiert habe, dass ich meine Messdaten aus der Maschine bekomme, und jemand die Maschine kapert, bekommt er die Messdaten. Wenn ich über dieselbe Leitung meine Maschine parametrisieren oder sogar die ganze Software austauschen kann, dann kann ein Hacker einen deutlich höheren Schaden anrichten. Deshalb muss ich peinlich auf die Absicherung achten. Frage: Welche neuen Skills müssen die Mitarbeitenden in der Fertigung für das SDM mitbringen? Riedel: In der Fertigung selbst keine. Die Werkerin oder der Werker werden nichts lernen müssen, aber Möglichkeiten bekommen, die sie bisher nicht hatten. Sie können z.B. die Kiste in einem Pick-by-Light-Regal einfach an eine andere Stelle verschieben, um sich nicht so häufig bücken zu müssen, weil jede Position, jede Kiste und jedes Teil in der Kiste miteinander vernetzt sind. Es blinkt dann einfach an einer anderen Stelle. Um das heute zu optimieren, müsste der Fertigungsplaner den Fertigungsplan ändern, neu programmieren, eine neue Prozessanweisung für die Logistik erstellen – ein riesenlanger Rattenschwanz. Frage: Gibt es kommerzielle Software-Anwendungen für SDM? Riedel: Es gibt für sehr viele Komponenten, die im SDM verwendet werden, kommerzielle Software, und es gibt viele Hersteller, die ihre Software entsprechend adaptieren, aber es gibt noch keinen, bei dem ich eine fertige SDM-Lösung kaufen kann, weil SDM eben sehr prozessabhängig ist. Aber alles, was es kommerziell gibt, sollte man versuchen zu verwenden, z.B. das Thema Verwaltungsschale. 
Frage: Wie sollten Unternehmen bei der Umstellung auf SDM vorgehen? Riedel: Ausgehend von unserem Dreieck aus Manufacturing, Digitalisierung und Business-Prozessen würde ich bei den Prozessen anfangen und schauen, wo sie zu teuer sind oder unrund laufen, und nicht in der Produktionstechnik oder der Digitalisierung ansetzen. Man kann sich die klassischen KPIs anschauen wie Overall Equipment Efficiency, Prozess-Effizienz, Prozesskosten, Anzahl der Gutteile etc. und dann überlegen, wo es Verbesserungspotenziale gibt, die ich mit Digitalisierung beheben kann. Frage: Gibt es schon Unternehmen, die SDM produktiv implementiert haben? Riedel: Die gibt es, aber ich weiß nicht, ob ich Namen nennen darf. Im Automotive-Umfeld sind es eher die Zulieferer, die vorpreschen, weil sie unter einem ganz anderen Druck stehen als die OEMs. Und es gibt ein paar mutige Unternehmen in der Investitionsgüter-Industrie, d.h. größere Anlagenbauer, die Vorteile für sich und für ihre Kunden sehen. Frage: Welche Benefits versprechen sich die Unternehmen vom SDM, abgesehen von der Flexibilisierung? Riedel: SDM geht weiter als die reine Flexibilisierung. Ich kann damit komplett neue und unvorhergesehene Produktionsprozesse abbilden. Ich muss nicht genau wissen was und wie genau ich zukünftig produziere. Solange es mit meinem Equipment physikalisch machbar ist, muss ich lediglich die Software anpassen oder Teile davon austauschen. Ich bin also komplett wandlungsfähig. Das bietet enormes Potential für Optimierungen, für neue Geschäftsmodelle und auch für den Einsatz von KI, wenn Ihre Leistungsfähigkeit weiter zunimmt. Frage: Welche Forschungsprojekte zum Thema SDM laufen an der Uni Stuttgart? Riedel: Wir haben gemeinsam mit der Uni Karlsruhe ein vom Bund massiv gefördertes Projekt für die Fahrzeugfertigung gemacht, das sich SMD4FZI nennt. In diesem Projekt haben wir uns ganz stark auf die Fertigungsprozesse in der Automotive-Industrie fokussiert, primär im Bereich der Metallverarbeitung und der getakteten Variantenfertigung, d.h. da, wo die Automobil-Hersteller heute irre lange Vorlaufzeiten haben und bei jeder Änderung Stillstandzeiten von ein paar Wochen. Der Demonstrator, den wir entwickelt haben, steht bei mir im Institut für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen (ISW) der Uni Stuttgart. Herr Prof. Riedel, vielen Dank für das interessante Gespräch. 
Zur Person Prof. Dr.-Ing. Oliver Riedel studierte Technische Kybernetik an der Universität Stuttgart und promovierte dort auch. Seit über 25 Jahren beschäftigt er sich mit den Grundlagen und der praktischen Anwendung von Methoden der virtuellen Absicherung in Produktentwicklung, Produktion und Service. In dieser Zeit war er in zahlreichen Führungspositionen u. a. im VW-Konzern tätig. Im November 2016 folgte Prof. Riedel dem Ruf an die Universität Stuttgart. Dort hat er den Lehrstuhl für Produktionstechnische Informationstechnologien inne, leitet das Institut für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen (ISW), und ist Dekan der Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik. Außerdem ist er seit Juni 2018 Institutsleiter am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Prof. Riedel ist Mitglied der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Produktentwicklung und Vorstandsvorsitzender des VDI-Landesverbandes Baden-Württemberg. |
|
| © PROSTEP AG | ALL RIGHTS RESERVED | IMPRESSUM | DATENSCHUTZERKLÄRUNG | HIER KÖNNEN SIE DEN NEWSLETTER ABBESTELLEN. |
